Künstliche Befruchtung
„Ich war sehr überfordert mit meinen Emotionen“
Um alleinstehenden Frauen den Zugang zu künstlicher Befruchtung zu ermöglichen, haben Anfang Oktober 22 Mütter erfolgreich einen Antrag beim Obersten Gerichtshof eingebracht. In Deutschland sei die In-vitro-Fertilisation für alleinstehende Frauen bereits erlaubt, sagte Reproduktionsmediziner Andreas Obruca. Die „Krone“ hat mit ihm und der Betroffenen Natascha über die Möglichkeiten und Grenzen der IVF gesprochen.
Die In-vitro-Fertilisation ist eine Methode der künstlichen Befruchtung, bei der Eizellen und Spermien außerhalb des Körpers im Labor zusammengeführt werden. Die so entstandenen Embryonen werden einige Tage lang kultiviert und anschließend in die Gebärmutter der Frau zurückgesetzt. „Die Erfolgschance ist die erste Frage vieler Paare. 100 Prozent wäre unseriös“, sagt Reproduktionsmediziner Andreas Obruca, der das Kinderwunschzentrum an der Wien leitet. Die tatsächliche Spanne liege bei 10 bis 60 Prozent, wobei 60 Prozent die Ausnahme sei. Das Alter und die Indikation der Paare spielen mit.
„Wir können eine Prognose für die Qualität der Embryonen abgeben. Die IVF ist ein Versuch. Es kann zum Beispiel gar keine Einnistung da sein, auch ein Abort (Fehlgeburt, Anm.) ist möglich. Einige hören nach dem zweiten oder dritten Versuch auf“, sagt Obruca. In seinem Kinderwunschzentrum werden jährlich etwa 2000 Patientinnen behandelt, das sind durchschnittlich fünf bis sechs pro Tag. In ganz Österreich sind es 17.000 bis 18.000 pro Jahr. Diese Zahl blieb in den vergangenen Jahren stabil, geändert haben sich das Alter der Patientinnen – von Mitte 20 vor 30 Jahren auf oft Ende 30 oder Mitte 40 – und die Familienstrukturen. Die Diversität der Gesellschaft spiegle sich wider, man betreue unter anderem lesbische Paare oder Alleinstehende, die für die weitere Behandlung aufgrund der gesetzlichen Vorgaben jedoch ins Ausland gehen müssen.
Die IVF ist ein Versuch. Es kann zum Beispiel gar keine Einnistung da sein, auch ein Abort (Fehlgeburt, Anm.) ist möglich.

Andreas Obruca, Reproduktionsmediziner
Bild: ANNA STOJAN
Betroffene: „Ich war euphorisch und habe viel gehofft“
Eine der Patientinnen ist Natascha (32), die die Behandlung mit 28 Jahren begonnen und heute einen eineinhalbjährigen Sohn hat. Das Spermiogramm (Analyse der Spermien, um männliche Fruchtbarkeit zu beurteilen, Anm.) ihres Partners sei auffällig gewesen, erinnert sie sich. Daher sei klar gewesen, dass es mit einer Schwangerschaft auf natürlichem Weg nicht klappe. Es folgte eine Hodenbiopsie (Gewebe aus Hoden wird entnommen, um Spermien zu gewinnen oder die Ursache für Unfruchtbarkeit zu ermitteln), was aber auch keinen Erfolg brachte. Daraufhin haben sich die beiden verschiedene Methoden angehört und sich für eine Samenspende entschieden. In Österreich ist die Samenspende zur IVF-Behandlung seit 2015 erlaubt, dabei stellt ein Mann einem Paar sein Sperma zur Verfügung. Er gilt rechtlich nicht als Vater und ist auch nicht unterhaltspflichtig.
„Ich war anfangs sehr euphorisch und habe viel gehofft. Man wird nicht herkommen, wenn man sich denkt, das kann nie im Leben klappen“, sagt Natascha. Bei ihr und ihrem Partner waren letztendlich sogar zwölf Versuche bis zum Erfolg nötig – eine ungewöhnlich hohe Zahl, wie Obruca sagt. Woran das liegt, wissen sie nicht. Die Eizellenqualität nehme erst später ab, sagte Obruca. Überhaupt seien manche Störungen, die zu Unfruchtbarkeit führen, schwer messbar. Bei jeder fünften Person wird kein Grund gefunden.
Begriffe im Überblick
- Künstliche Befruchtung: medizinische Behandlung, um eine Schwangerschaft herbeizuführen
in Österreich z.B. IVF und ICSI (Spermieninjektion, einzelnes Spermium wird in Eizelle injiziert) erlaubt, verboten z.B. Spende von bereits vorhandenen Embryonen - In-Vitro-Fertilisation: Eizelle und Spermien werden außerhalb des Körpers im Labor zusammengeführt, Embryonen werden kultiviert und in Körper der Frau zurückgesetzt; Chance einer Schwangerschaft zwischen 10 und 60 Prozent
- IVF-Fonds: finanzielle Unterstützung für Paare (homosexuelle Männer ausgenommen); übernimmt 70 Prozent der Kosten für bis zu vier Versuche, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden (Alter, Indikation), durchschnittlich sind mehr als 1000 Euro pro Behandlung selbst zu zahlen
- Unfruchtbarkeit: wenn bei regelmäßigem, ungeschütztem Sex zu optimalen Zeitpunkten über mindestens ein Jahr keine Schwangerschaft eintritt (WHO)
Finanzielle Unterstützung nur mit Indikation
In Österreich übernimmt der IVF-Fonds (finanziert von Gesundheitskassen und dem Familienlastenausgleichsfonds, Anm.) 70 Prozent der Kosten für bis zu vier Versuche. Nach einer bestätigten Eileiterschwangerschaft oder einer Fehlgeburt wird neu gezählt. Dafür müssen Paare jedoch verschiedene Voraussetzungen erfüllen, wie ein bestimmtes Alter (Frau unter 40 Jahre, Mann unter 50 Jahre zu Beginn der Behandlung) und eine nachgewiesene Indikation. Auch Natascha und ihr Partner haben die finanzielle Unterstützung in Anspruch genommen, um den Antrag haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kinderwunschzentrums gekümmert. Der Spendersamen selbst werde nicht übernommen, ergänzt Obruca.
Es war schon normal, dass es nicht klappt. Ich war dann sehr überfordert mit meinen Emotionen, als der Schwangerschaftstest positiv war.
Natascha hat ein Kind mithilfe von künstlicher Befruchtung bekommen.
„Viele fragen den Arzt auch, wer an der Unfruchtbarkeit schuld sei. Ein Kinderwunsch ist aber eine gemeinsame Geschichte.“ Das bestätigt Natascha. Die Schuldfrage habe ihren Partner anfangs sehr belastet. Man habe aber dann festgestellt, dass eine Samenspende auch nicht so einfach sei. „Es war schon normal, dass es nicht klappt. Ich war dann sehr überfordert mit meinen Emotionen, als der Schwangerschaftstest positiv war“, sagt sie.
Arzt: „Immer noch ein bisschen ein Tabuthema“
Durch Gespräche in ihrem Umfeld erfuhr die Volksschullehrerin, dass viele Menschen in einer ähnlichen Situation sind. Sie habe offen darüber sprechen können, wendet aber ein, dass das wohl nicht für alle Betroffenen selbstverständlich sei. „Es hat sich viel geändert, aber künstliche Befruchtung ist immer noch ein bisschen ein Tabuthema, ein offener Umgang damit schwierig. Unsere Durchschnittspatientin ist berufstätig. Wir geben neutrale Bestätigungen für den Arbeitgeber aus, damit der Kinderwunsch am Arbeitsplatz nicht bekannt wird“, sagt Obruca, der auch Präsident der österreichischen IVF-Gesellschaft ist. Schließlich könnte es andernfalls berufliche Nachteile für die Betroffene geben.
Unsere Durchschnittspatientin ist berufstätig. Wir geben neutrale Bestätigungen für den Arbeitgeber aus, damit der Kinderwunsch am Arbeitsplatz nicht bekannt wird.
Andreas Obruca, Reproduktionsmediziner und Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien
Was Natascha anderen Betroffenen rät? „Holt die Informationen ein, die ihr haben möchtet. Es gibt auch Selbsthilfegruppen und Vereine, vor allem in Wien gibt es mehr als in einem Dorf in Österreich. Und Reden hilft. Man kann auch anonym bleiben“, sagt sie mit Blick auf die Möglichkeit, online ohne Kamera und Namen an einem Treffen eines Vereins oder einer Selbsthilfegruppe teilzunehmen.
Man sei nicht allein, auch wenn es sich anfangs vielleicht oft so anfühle. Sie und ihr Partner haben nie daran gezweifelt, die Behandlung fortzusetzen, und planen bereits das zweite Kind auf diesem Weg.



Mehr Leben
















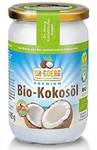








Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.