Zum Welt-Aids-Tag
Matteo Haitzmann: „Hatte als Schwuler immer Angst“
Matteo Haitzmann verarbeitet auf seinem ambitionierten Projekt „Those We Lost“ die Geschichte von Aids und HIV und recherchierte dabei aufwändig und sehr akribisch. Im Interview erklärt er uns, wie wichtig Kunst und Aktivismus sind, wie sich die Situation veränderte und warum er mit Workshops aufs Land in die Schulen geht.
Matteo Haitzmann kennt man als Musiker von Alma und Little Rosie‘s Kindergarten, als Geiger oder als Performer. In den letzten Jahren hat er sich intensiv mit der Geschichte der Aids-Krankheit beschäftigt und aus unheimlich viel Recherchematerial, eigenen Eindrücken und viel Liebe zum Detail das Projekt „Those We Lost“ geformt. Auf CD und in einem Begleitbuch erzählt er von den schikanösen Bedingungen und Diffamierungen von Aids-Krankheiten in den 80ern und wie sich die Geschichte mithilfe von Kunst und Kultur gewandelt hat. Mit dem Programm geht er nicht nur auf die Bühne, er bringt das scheinbar so schwere Thema auch Kindern und Jugendlichen am Land näher.
„Krone“: Matteo, dein Soloprogramm „Those We Lost“ ist ein sehr schweres, intensives, aber auch wundervolles Album geworden. Wo und aus welchem Grund entstand eigentlich die Idee dazu?
Matteo Haitzmann: Die Grundidee entstand ein halbes Jahr vor der Pandemie. Ich war erstmals tiefer in der Recherche und habe gemütlich dahingearbeitet, als plötzlich Covid kam und alles brisanter wurde. Ich wollte ursprünglich gar kein so relevantes Stück machen, sondern eher gemütlich dahinarbeiten. (lacht) Ich bekam damals das Buch „The Ward“ von Gideon Mendel in die Hand, für das er Aidskranke in einem Hospiz fotodokumentarisch begleitete. Ich habe erst bei der Recherche bemerkt, wie wenig ich davon weiß und wie groß diese Tragödie früher war. Sie hat mich nicht mehr losgelassen.
Aids ist glücklicherweise nicht mehr so dramatisch wie es vor 30-40 Jahren war, aber natürlich immer noch präsent und gefährlich. Willst du das Thema nun einer jüngeren Generation näherbringen, die vielleicht nicht mehr so den Zugang dazu hat?
Ich möchte das Thema in Erinnerung rufen und die Leute darauf hinweisen, wie viel wir dieser Bewegung von damals zu verdanken haben. Sie hatte in den 80ern die ganze Medienarbeit geleistet. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan hat erst nach zehn Jahren erstmals das Wort Aids in der Öffentlichkeit in den Mund genommen. Die Aktivisten haben Geldförderungen möglich gemacht und viel Licht auf das Thema gebracht. Unabhängig davon hat die LGBTQ-Gemeinschaft der Bewegung viel zu verdanken, was Selbstbewusstsein und Identität angeht.
Man kann sich heute gar nicht mehr vorstellen, gegen welche Wände Aids-Kranke und Homosexuelle damals noch laufen mussten und wie schwierig es war, nicht von der Gesellschaft geächtet zu werden.
Das hat mich fasziniert: sie haben performative Elemente verwendet, um Aktivismus und Kunst zu verbinden. Da steckten viele geniale Köpfe dahinter, die ihr vielseitiges Wissen verwendet haben, um eine Bewegung zu schaffen. Ich habe aus dem Thema auch eine Schulversion für Schülerinnen von 14 bis 18 gemacht. Mit der Mischung aus Aktivismus und Kunst trifft man die junge Generation gut. Man muss sich Methodik und Strategien anschauen, dann kriegt man sie. Man verpackt dabei das LGBTQ-Thema, ohne es extra anzusprechen. Das erschafft wiederum viel Empathie.
Wie gehst du bei der Umsetzung für Jugendliche an das Thema ran, um quasi noch eine Subebene dazu zu finden?
Ein Anliegen von mir war ein Workshop-Format für Landschulen. Ich bin Salzburger, komme selbst vom Land und wollte unbedingt etwas machen, womit man die Thematik gut in die Schulen tragen kann. Es gibt schon ähnliche Formate, aber mir war wichtig, das Thema mit Kunst zu vermischen. Nicht nur über etwas reden, sondern die Leute für das Thema öffnen. Ich arbeite erst drei Stunden mit den Leuten, schreibe mit ihnen Gedichte und bastle. Dann zeige ich den Vortrag. Dadurch sind sie schon so auf das Thema sensibilisiert, dass die Toleranz viel höher ist. Das Fernziel wäre es, das ganze Thema in ein Schulprogramm reinzubringen. Vielleicht ein Förderprogramm. Dass man dann zum Beispiel sechs Mal pro Jahr so einen Workshop macht. Die Reaktion der Kids war extrem gut, das hat mich echt überrascht.
Verständnis und Toleranz für diese Themen sind am Land immer noch geringer als im urbanen Raum. War das der Hauptgrund, warum du in diese Richtung gehst?
Ich hätte mir das bei meinem Aufwachsen gewünscht. Dass da jemand draußen steht und sagt, er sei schwul und einen Workshop anbietet. Das klingt so pathetisch, aber es hätte mir sehr geholfen. Ich habe den ersten anderen schwulen Menschen mit 17 kennengelernt. Ich will etwas Ästhetisches und Schönes machen und dass die Menschen jemanden sehen, der mit Selbstbewusstsein über das Thema spricht.
Waren die Veränderungen und Aufbrüche zum Thema Aids damals auch aus der Kunstperspektive bahnbrechend?
Es gab aktivistische Aktionen, die auf starken Gegenwind stießen. So wie etwa die ganz große Störung 1989 in der St. Patricks Cathedral in New York, wo sich Aidskranke drinnen hinfallen ließen und quasi tot waren. Eine meiner Lieblingsaktionen ist jene, wo sie einem ganz homophoben US-Senator ein Riesenkondom über das Haus stülpten. Sie haben sich mit Greenpeace zusammengetan und die hatten Expertisen, wie man Dinge sehr schnell befestigt. Die aktivistischen Bewegungen haben immer voneinander gelernt. „Diva-TV“ ging damals schon herum und hat Polizeigewalt dokumentiert, wie man es heute oft mit dem Handy macht.
Wie hast du das Thema dann für dich umgesetzt? Hast du dir eine Performance überlegt oder nur die Musik?
Beide Dinge liefen sehr lang parallel nebeneinander. Ich habe musikalisch viel probiert und es war nichts ausgeprägt, andererseits habe ich viel recherchiert. Tagebücher, Bücher und Dokumentationen angeschaut und positive Leute interviewt. Ich wollte ein Gefühl kriegen, wie Aids für jemanden in den 80ern war. Wie war der Alltag für die Betroffenen und für ihre Liebespartner oder Familien? Das war unglaublich aufwändig, aber es hat sich gelohnt.
Nebenbei spielst du ja auch bei Alma und Little Rosie’s Kindergarten. Wie gehen sich das Performative, der Jazz und dann auch noch diese große Recherche nebeneinander aus?
Es war natürlich viel, aber sowohl die CD-Aufnahme als auch das Begleitbuch waren eine andere Art zu arbeiten. Nicht so, wie man üblicherweise an Alben arbeitet.
Der Albumtitel spielt wahrscheinlich auf alle Menschen an, die wir an Aids verloren haben?
Genau. Es ist ein Tribut. Eine Verbeugung und Danksagung für die unglaubliche Kraft, die von diesen Menschen kam, obwohl so viel Leid herrschte.
Nur durch diese Knochenarbeit haben sich gesellschaftliche Dogmen verändert und Perspektiven gedreht. Gab es besonders zentrale, prägende Figuren, die du bei der Recherche entdeckt hast?
Es gibt einen Journalisten in Bern, der war eine der wichtigsten Inspirationsquellen. Marc Ph Meystre, der das Buch „Andere Inseln deiner Sehnsucht“ schrieb. Sein Freund war Geiger, Aids-positiv und starb daran. Marc schrieb dann ein Tagebuch darüber und dieses Werk war maßgeblich inspirierend für mich. Es hat sich da auch etwas ganz Unglaubliches ereignet. Es gibt einen Instagram-Account namens „The Aids Memorial“ und da werden jeden Tag Fotos von Verstorbenen von deren Hinterbliebenen hochgeladen. Plötzlich war das Foto von einem Geiger online und es stellte sich heraus, dass es genau der aus dem Buch war. Ich schrieb den Urheber an, dass ich ein Stück von ihm komponierte und so entstand ein Austausch, der zu privaten Fotos und tollen Details führte.
Willst du das Projekt noch weitertragen, nachdem du so tief in die Materie eingedrungen bist?
Die CD ist ja quasi schon ein kleines Buch. Damit ist das Thema jetzt wohl einmal gut. Es geht auch wirklich an die Substanz und ich habe mir überlegt, dass ich eher in die Richtung „Those We Love“ gehe. Aber das ist noch nicht ganz ausgefeilt und vorerst nur eine Überlegung.
Du kommst ja genauso aus dem Performativen wie aus der Musik. Wie hat sich die Idee schlussendlich so entwickelt, dass du Performance und Klang so vermischt?
Dahinter steckte ein ganz praktikabler Gedanke. Man hat auf Tour nie jemanden dabei, der Licht macht. So habe ich eine aufpumpbare Leinwand entwickelt, die man dann in einen Skisack wieder verpacken kann. Ich wollte Videos und O-Ton-Aufnahmen dazu vermischen. Es gibt eine zeitliche Reihung von Artikeln, beginnend von der ersten Beschreibung der Krankheit in einem Medical Paper. Ich habe gesamt für die Performance fünf Zeitungen zum Thema von 1981 bis heute verwendet und zeige dabei die Veränderung der Wahrnehmung. Am Anfang wurde die Krankheit noch GRILL, also „Gay Related Illness“ genannt. Heute ist das natürlich ganz anders. Dahinter steckt der Wunsch, dass alle auf sehr gut Recherchiertes zurückgreifen. Es muss immer Information sein, die unter Dach und Fach ist.
War es für dich schockierend, wie respektlos und intolerant man früher mit der Krankheit umging?
Extrem. Die bayrische CDU hatte einen Maßnahmenkatalog ausgegeben, wo es um Konzentrierung ging, um verpflichtende HIV-Tests und um die Aushebung der Degenerierten. Es stand sogar im Raum, die Betroffenen zu tätowieren. Das sind absolute Nazi-Methoden. Und das war in Bayern in den 80er-Jahren. Eins zu eins war es in Frankreich bei der Front National. Das Stigma war unendlich.
Ein bisschen erinnert mich das fast an die jahrelange leidige Diskussion um das Blutspenden bei Homosexuellen…
Und das war im Jahr 2022. Man muss sich noch bewusst machen, dass die Schwulen-Community früher völlig verpönt war. Selbst als ich jung war, schwang noch viel Angst mit. Eigentlich unglaublich.
Schwebte das Thema Aids auch immer über dich als schwulen Mann?
Durchaus. Ich hatte nie Angst daran zu sterben, aber eine gewisse Grundangst war da. Dass ich mich anstecke oder ein Kondom reißt. Auch Menschen, die positiv sind, waren erst dann entspannt, als die Medikation so weit war, dass sie selbst nicht mehr ansteckend sind. Davor hatten sie selbst immer Angst, die Krankheit weiterzugeben. Das war noch vor zehn Jahren so.
Welche Überlegungen steckten hinter dem Aufbau des Albums und der Songauswahl?
In der CD war mir ein Statement am Anfang am Wichtigsten. Es sollte keinen Interpretationsspielraum geben und das Thema sollte ganz klar positioniert sein. Das ist das Sample, das ich als „Why We Fight, Vito Russo“ verwendete. Bei der Performance ging ich eher von der Idee aus, dass jemand erkrankte und bereits im Bett liegt. Die Haut ist schon angespannt, das Fett verloren. Man denkt von dort aus rückblickend, wie die Schritte davor waren, die dazu führten. Der Körper zieht sich gänzlich zurück, bis man weg ist. Sehr wichtig war mir zudem das Thema Berührung. Sobald jemand positiv war, war von heute auf morgen jegliche Berührung weg. Bei den Fotos von Mendel war nicht nur Schmerz und Leid, sondern auch viel Intimität, Berührung und Zärtlichkeit zu sehen. Wie das Krankenhaus zum Wohnraum gemacht wurde.
Geht „Those We Lost“ nicht nur aufgrund deiner Aktivität in Schulen längst weit über den Kulturbereich hinaus?
Ich habe einen kleinen Bildungswunsch. Es geht nie um den erhobenen Zeigefinger, aber um ein Anbieten. Ich biete nach Vorstellungen auch immer ein Gespräch an, damit mich Leute nach der Performance alles fragen können. In einem Theater in Pinzgau sind wir mal lange gesessen und haben viel über das Thema geredet. Eine 75-jährige Dame sagte mir, sie hätte kein Wort verstanden, aber sie wüsste genau, was ich sagen will. (lacht) Das war total. Man eröffnet damit einen Diskurs und die Leute unterhalten sich auch untereinander. Ich muss schon aus der Theater- und Musikbubble raus, sonst bräuchte ich so ein Thema nicht angreifen.
Im besten Fall dann eben bis zum großen Diskurs.
Die Leute sind oft schockiert darüber, was früher passiert ist. Das alleine ist schon so viel Wert. Viele beginnen zu weinen und sind nach 20 Minuten komplett fertig. Es geht nicht nur um Schmerz und die Tränendrüse. Das auszuschlachten wäre respektlos. Es gab auch ganz viel Kampfeslust, Kraft, Liebe und Motivation. Bei mir steht im Vordergrund, was die Menschen trotz aller Anstrengungen geschafft haben und wie viel Gemeinschaft und Freude es gab. 1996 kamen endlich Medikamente auf und viele, die stark involviert waren, hatten sich so nach dieser Zeit gesehnt. Einfach berührend. Ich habe auch viel weggelassen. Es gab mal einen Aufruf, woraufhin sie vor dem Weißen Haus die Asche von Verstorbenen ausstreuten. Das waren Tausende Leute. Diese Videos waren unglaublich zu sichten. Es passierte nie aus Sensationsgeilheit, sondern als letzte Möglichkeit, um auf sich aufmerksam zu machen. Wer will die Asche einer geliebten und verstorbenen Person vor einem politischen Haus verstreuen, von dem er sich nicht vertreten fühlt? Da spürt man die gesamte Verzweiflung.
Live in Tirol und Salzburg
Mit seinem ambitionierten und sehr opulenten „Those We Lost“-Programm kommt Matteo Haitzmann heute (1. Dezember) Abend ins Innsbrucker Treibhaus und am 2. Dezember in die ARGEKultur Salzburg. Unter www.oeticket.com gibt es weitere Infos und die Karten. Das sollten Sie nicht verpassen.








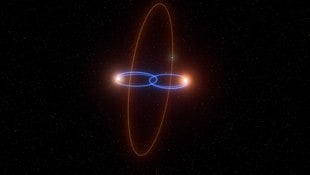















Kommentare
Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.
Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.
Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.